Das Recht als Hebel im Kampf gegen die Klimakrise
Ein Rückblick auf die Podiumsdiskussion unserer Veranstaltungsreihe „Zukunft. Klima. Demokratie.“ am 28. Januar 2025 in Hamburg
Die Klimakrise bedroht unsere Rechte auf Freiheit, Eigentum, Leben und körperliche Unversehrtheit. Immer häufiger setzen Aktivist*innen sowie Umwelt- und Naturschutzorganisationen juristische Mittel ein, um Klimaschutz durchzusetzen. Doch wie erfolgreich sind diese Klagen? Wo liegen Chancen und Grenzen der Rechtsprechung im Klimaschutz? Über diese Fragen diskutierten unsere Gäste Luisa Schneider (Unabhängiges Institut für Umweltfragen), Dr. Cornelia Nicklas (Deutsche Umwelthilfe), Marissa Reiserer (Greenpeace), Lea Frerichs (Universität Hamburg) und John Peters (Kanzlei Rechtsanwälte Günther).
Ein Klimaschutzgesetz allein schützt das Klima noch nicht – es muss auch umgesetzt werden. So stellt Luisa Schneider gleich zu Beginn der Veranstaltung klar: „Im Umweltrecht gibt es ein klares Vollzugsdefizit.“ Daher nutzen Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft Gerichte als rechtliches Korrektiv, auch im Kampf für mehr Klimaschutz. Insgesamt wurde das Instrument der Umweltverbandsklage zwischen 2017 und 2023 fast 450-mal genutzt, Tendenz steigend. Etwa die Hälfte dieser Fälle ging für die Kläger*innen erfolgreich aus.
Gerichte als Orte des Klimaschutzes
Derzeit besonders bekannt ist die Zukunftsklage von Greenpeace und Germanwatch, der sich innerhalb kürzester Zeit über 50.000 Menschen anschlossen. Gemeinsam fordern sie die Umsetzung des Klimaschutzurteils des Bundesverfassungsgerichts von 2021. Umweltpsychologin Marissa Reiserer ist Mitinitiatorin der Klage und sieht den Grund für den großen Zulauf darin, dass die Menschen sehr wohl dazu bereit sind, ihre Rechte vor Gericht einzuklagen. Häufig scheitere es jedoch an juristischem Wissen und den finanziellen Ressourcen für derart aufwändige Klagen.
Dass Gerichte zunehmend genutzt werden, um Klimaschutz auf dem Klageweg zu erreichen, steht aber auch in der Kritik. Schließlich braucht es für eine nachhaltige Transformation hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft einen möglichst breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Dieser kann durch Gerichtsurteile nicht erzwungen werden. Nichtsdestotrotz sind Gerichte aktuell leider ein wichtiger Hebel für den Klimaschutz, so Rechtsanwalt John Peters – insbesondere angesichts der sinkenden Priorität von Klimathemen in der Öffentlichkeit und des steigenden Zeitdrucks. „Wenn die Gesetzgebung zu schwach ist, schlägt die Stunde der Gerichte“.
Soziologin Lea Frerichs ergänzt dazu, dass Klimaklagen auch eine Rolle als Treiber für mehr Klimaschutz einnehmen. Gerichtsurteile allein führen zwar noch nicht zu einer sozial-ökologischen Transformation, doch juristische Mittel können den Weg zur Klimaneutralität beschleunigen, indem sie die Legitimität des Anliegens erhöhen und öffentliche Debatten fördern. So konnte Frerichs in einer Diskursanalyse bereits feststellen, dass die mediale Berichterstattung über Klimaklagen deutlich weniger polarisierend ist als über Klimaproteste.
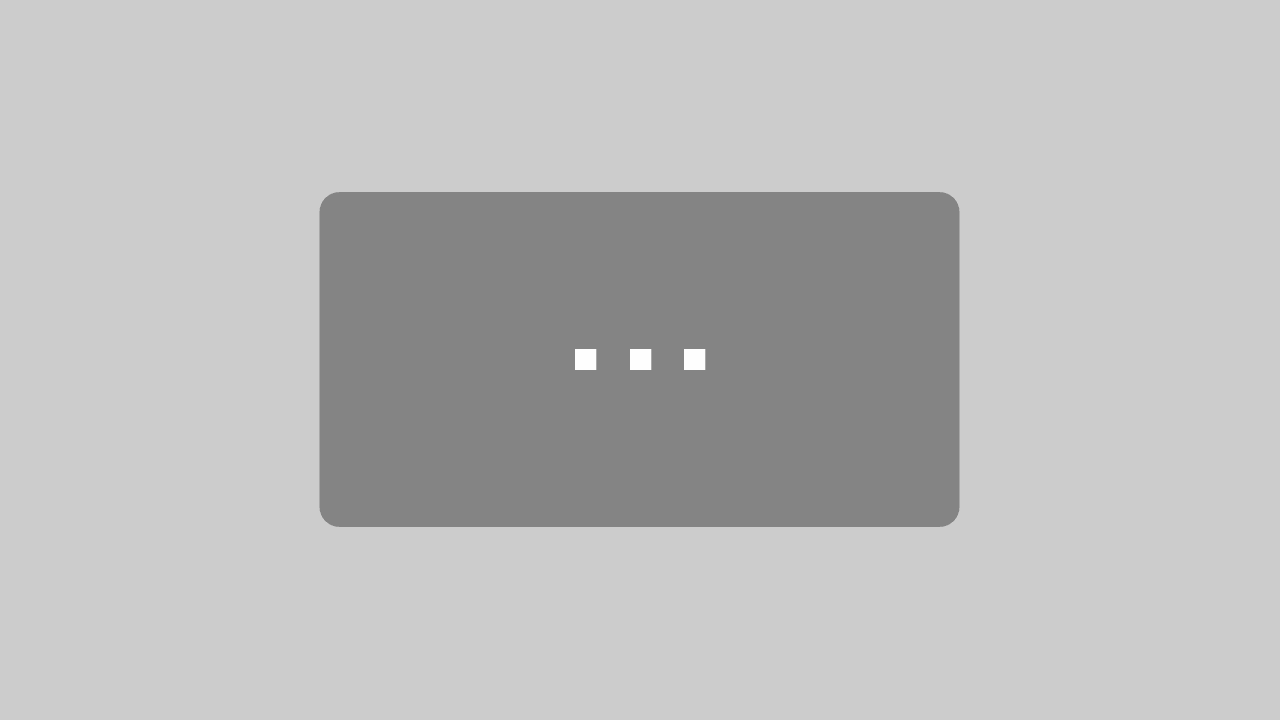
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Verbandsklagerecht in Gefahr
Trotz der vielfältigen Nutzung des Verbandsklagerechts sehen die Jurist*innen Nicklas und Peters Nachbesserungsbedarf im Klagerecht. Der aktuelle Rechtsrahmen erschwere durch seinen Fokus auf Umweltschutz Klagen zur Klimaschutzgesetzgebung und stehe ohnehin nicht mehr im Einklang mit der Aarhus-Konvention, die als Vorlage für das Recht diene. Eine explizite Klimaverbandsklage oder eine Generalklausel könnte die gerichtliche Behandlung von Klimaschutzfällen erleichtern.
„Allerdings sind die politischen Tendenzen eher gegenläufig“, fügt Nicklas hinzu. Statt einer Weiterentwicklung der rechtlichen Möglichkeiten sehe sich das Verbandsklagerecht derzeit Angriffen durch konservative und rechte Kräfte ausgesetzt. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz formuliert offen, das Instrument stark einschränken zu wollen. Insofern sei es jetzt geboten, die Kräfte auf die Erhaltung der bestehenden Möglichkeiten zu konzentrieren. Klimaklagen seien zwar kein Allheilmittel, doch sie stellen in der aktuellen Zeit eine wichtige Konstante dar, waren sich die Podiumsgäste einig.
Die Veranstaltung ist Teil der Reihe "Zukunft. Klima. Demokratie.", die BürgerBegehren Klimaschutz (BBK) gemeinsam mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) organisiert.
Fotos: Björn Obmann
Weitere Veranstaltungen
-
Mehr lesen
Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz - Das Grundgesetz und die Frage der Finanzierung
Ein Rückblick auf die Online-Veranstaltung am 03. Dezember 2024 mit Alice… -
Mehr lesen
Zukunft. Klima. Demokratie. – Allianzen für soziale Gerechtigkeit
Ein Rückblick auf die Podiumsdiskussion mit Astrid Schaffert, Dr. Petra Sitte,… -
Mehr lesen
Zukunft. Klima. Demokratie. – Solidarität statt Populismus
Zukunft. Klima. Demokratie. – Solidarität statt Populismus Ein Rückblick auf die…











