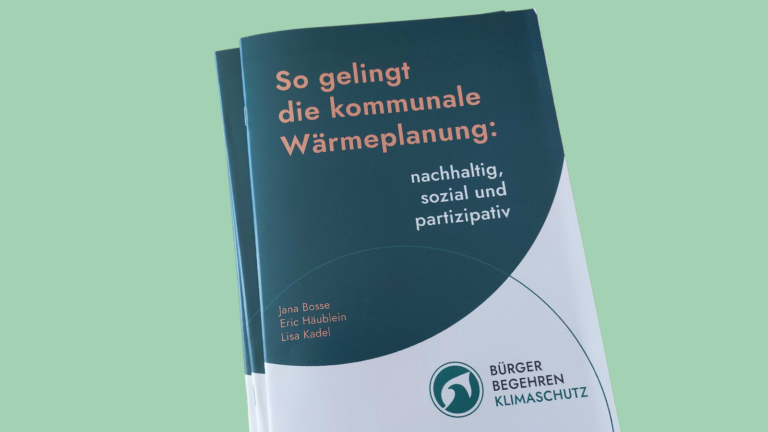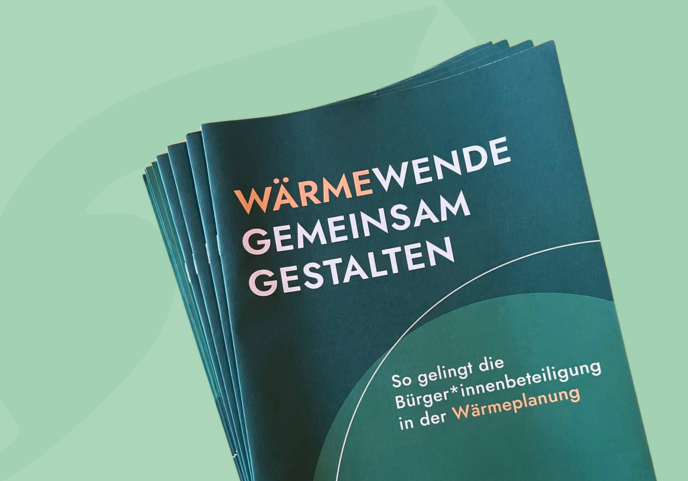WÄRME.WISSEN.
KOMPAKT
Technologien für erneuerbare Wärme
Alles was du schon immer über Wärmepumpe, Geothermie und Co. wissen wolltest
Alle reden über die Wärmepumpe, aber wie genau funktioniert die eigentlich? Wir stellen in dieser Reihe die wichtigsten Technologien für eine erneuerbare Fernwärmeversorgung vor. Einerseits erklären wir die Funktionsweise der Technologie und wie das Potenzial erschlossen werden kann. Andererseits gibt es in jedem Fact Sheet konkrete Praxisbeispiele. Gemeinsam mit dem Leitfaden zur kommunalen Wärmeplanung schaffen sie einen guten Überblick und den Weg zur klimaneutralen, sozialen und partizipativen Wärmewende einerseits und zur technisch machbaren Seite der Wärmewende und den zu erschließenden Wärmepotenzialen andererseits.
Die Wärmepumpe
Die Wärmepumpe wird die entscheidende Heiztechnologie der erneuerbaren Wärmeversorgung. Luft- und Erdsondenwärmepumpen machen sich die Umgebungstemperatur zueigen und heben sie auf ein höheres Niveau zum Heizen.
Die Flusswärmepumpe
Da Flüsse und Seen auch im Winter über deutlich höhere Temperaturen als die Umgebungsluft verfügen, sind sie hervorragende Wärmelieferanten. Durch Fluss- und Seewärmepumpen können sie einen signifikanten Beitrag zur Deckung des Fernwärmebedarfs leisten.
Abwasser-Wärmepumpe
Häusliches und betriebliches Schmutzwasser verfügt während der Heizperiode über Temperaturen von 10- 15°C und bietet sich damit auch im Winter als Wärmequelle an. Diese Restwärme lässt sich mit einer Wärmepumpe auf die erforderliche Heiztemperatur anheben.
Solarthermie
Solarthermie nutzt die Strahlungsenergie der Sonne. In Solarthermiekollektoren wird dafür eine Flüssigkeit erwärmt, und die Sonnenwärme wird anschließend mittels eines Wärmeübertragers direkt genutzt oder an einen Speicher abgegeben.
Tiefe Geothermie
Als Geothermie wird die Wärme der Erde bezeichnet, die mithilfe von Bohrungen nutzbar für die Wärmeversorgung gemacht werden kann. Bei der tiefen Geothermie wird bis zu fünf Kilometer tief in die Erdschichten eingedrungen.
Industrielle Abwärme
In vielen industriellen Prozessen entsteht Abwärme, die nicht weiter genutzt wird und einfach verpufft. Dabei kann die entstandene Wärme auch in unsere Wärmenetze eingespeist und für nachhaltigeres Heizen genutzt werden.
Abwärme aus Rechenzentren
Auch in Rechenzentren stecken riesige Potenziale für die Fernwärmeversorgung. Die entstehende Abwärme lässt sich leicht nutzen, wenn dies bereits beim Bau der Rechenzentren eingeplant wird.
Power-to-Heat
Beim Power-to-Heat-Verfahren wird Wasser in einem Elektrodenheizkessel erhitzt. Es ist weniger effizient als der Einsatz von Wärmepumpen, ist aber sinnvoll, um überschüssigen erneuerbaren Strom nicht zu verschwenden.
Wärmespeicher
Damit erneuerbare Wärme ganzjährig verfügbar ist, braucht es Wärmespeicher. Die Wärmespeicher in Zukunft werden bereits Teil des lokalen Wärmekonzepts sein und vorzüglich erneuerbaren Überschussstrom zum Aufheizen verwenden.
Wasserstoff
Wasserstoff lässt sich effizient speichern und flexibel einsetzen. Aber nur mit erneuerbarem Strom hergestellter Wasserstoff ist klimafreundlich und davon sollte vor allem Überschussstrom zur Wasserstoffelektrolyse verwendet werden.
-
Mehr lesenViele Menschen sind verunsichert, wie sich der Weg zu einer klimaneutralen…
-
Mehr lesen
So gelingt Bürgerbeteiligung in der Wärmeplanung
Politiker*innen, Bürgermeister*innen und Klimaschutzmanager*innen stehen derzeit vor großen Herausforderungen: In ihren…